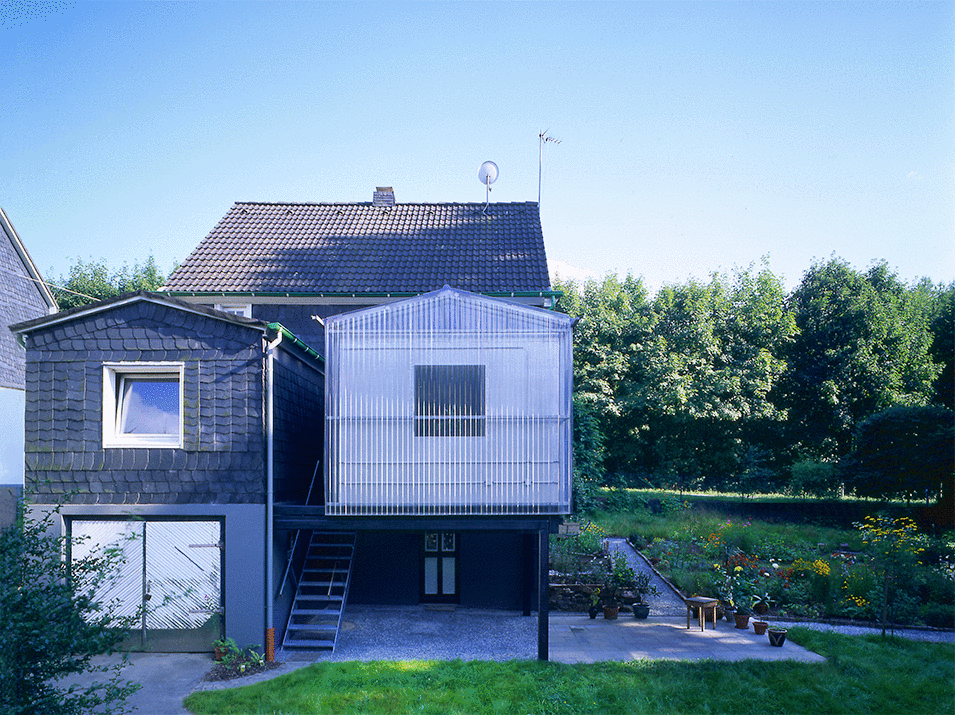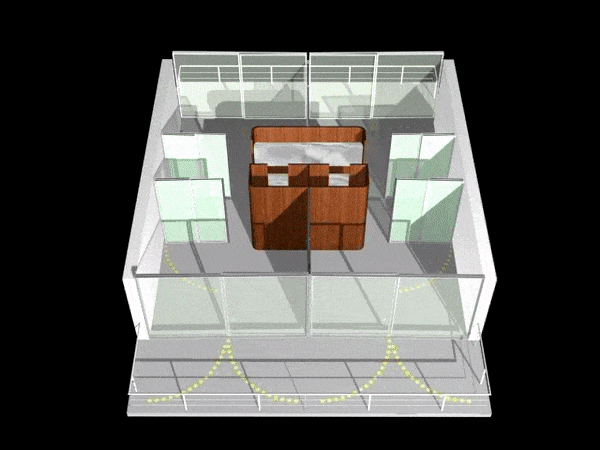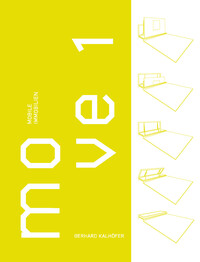

move, mobile immobilien: Forschungsarbeit zum Thema Nutzungsverdichtung
Die Debatte zwischen denen, die Architektur von der Form, und denen, die sie vom Gebrauch aus denken, zieht sich seit den 1960er Jahren durch die Architekturszene. Man kann die Haltung beider Strömungen mit dem einfachen Muster der Freudschen Psychoanalyse beschreiben. Auf der einen Seite sind diejenigen, die die Lösung in der Ordnung und klaren Struktur sehen, die Regeln erstellen, kontrollfixiert auch über die Fertigstellung des Projektes sind und Formen repetitiv anwenden. Sie entsprechen dem Freudschen Über-Ich und neigen zu repräsentativer Architektur. Ihre Bauherren sind in erster Linie Vertreter der staatlichen oder ökonomischen Elite. Dem Über-Ich quasi in Daueropposition verbunden sind die Unkonventionellen, Intuitiven und Situationsgesteuerten, für die das Andere und Fremde, das Ungewohnte und nicht Steuerbare in der Architektur eine Qualität ausmacht. Ihrer Überzeugung nach ist eine Architektur des Erlebnisses der Komplexität und Widersprüchlichkeit vorzuziehen. Sie sind Vertreter des Es. Für Freud ist die zentrale Aufgabe die Integration und Balance der Es- und Über-Ich-Elemente im Ich. „Ein übermächtiges Über-Ich droht die vitalen und kreativen Energien zu zerstören und die Lebensfreuden zu ersticken − es verursacht Neurosen. Ein übermächtiges es untergräbt jede Chance auf planvolles rationales Handeln.
Anders formuliert sind zwei Alternativen erkennbar: „Architekturen, die ihre Qualität aus physischen Realitäten ableiten, und diejenigen, die ihre Qualität daraus ableiten, was sie ermöglichen.
Das Buch nimmt Position ein und favorisiert eindeutig eine offene Architektur. Jeder mag für sich selbst klären, welche Richtung ihm sympathischer erscheint. Bevor das Thema im weiteren vertieft wird sollte man sich folgende Fragen stellen:
-> Informieren Sie Bauherren offen oder strategisch?
-> Bestehen Sie auf der Baustelle auf die unbedingte Ausführung, oder lassen Sie mit sich reden?
-> Stört Sie ein Bauherr, der an Ihrem Projekt weiter baut?
-> Kommen Sie auch nach Einzug der Bauherren noch einmal mit den Fotografen vorbei?
Ausgangspunkt
Die Vorstellung eines omnipotenten Raumes, der das Trennende überwindet und nur temporär notwendige Grenzen zwischen innen und außen zieht, der Funktionen oder ihre räumlichen Erscheinungen nicht zum Dauerzustand macht, der unterschiedliche und auch gegensätzliche Qualitäten bereitstellt, die Vorstellung eines Raumes der Komplexität, der sich frei zwischen verschiedenen Zuständen bewegt und trotz aller Veränderungsmöglichkeiten einen auch wieder zum Ausgangspunkt zurückführt, ein Raum, dessen Omnipotenz nicht belastet, sondern zu Entdeckungen anregt − diese Vorstellung ist heute möglich.
Mehrere Entwicklungen bilden die Grundlage:
-> eine fortschreitende gesellschaftliche Liberalisierung
-> eine rasante technische Entwicklung
-> und eine Emanzipation der Gesellschaft bei der Nutzung von Technik
Die Modelle und theoretischen Auseinandersetzungen zu interaktiven und mobilen Systemen sind nicht neu und seit den 1960er Jahren bekannt. Nach der Postmoderne erfährt die Idee des wandelbaren Raumes jedoch wieder einen Schub. Was aber ist heute anderes? Gibt es andere Bedingungen, die die Hauptkritik einer mangelnden Nutzung der flexiblen Räume außer Kraft setzen?
Die entscheidenden Unterschiede, die die Nutzung interaktiver Systeme erleichtern und ihnen nicht nur medial eine neue Bedeutung verleihen, sind seit den 1960er Jahren in der gesellschaftlichen Entwicklung zu erkennen. Die Nutzung von architektonischen Angeboten setzt selbstbestimmte, aktive Persönlichkeiten voraus, die sich über die Angebote im Klaren sind und zudem über die Entscheidungsfähigkeit verfügen, diese auch zu nutzen. Die 1960er Jahre haben durch die gesellschaftliche Liberalisierung die Grundvoraussetzungen geschaffen.
Flexibilität − die Befreiung von den Bindungen an den Grundriss − war die architektonische Antwort der 1960er Jahre auf diese Entwicklung. Trafen diese Vorstellungen damals nur bei einer begrenzten Zahl von Nutzern auf Akzeptanz, sind sie heute selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft. Wir haben heute die starren Bindungen vertrauter Milieus verlassen und wechseln unaufgeregt zwischen verschiedenen Arbeitswelten und Arbeitsformen. Unsere Alltagsprodukte zeichnen sich aus durch beschleunigte Reaktionen auf veränderte Verbraucherwünsche und bedienen immer komplexere Nutzungsanforderungen. Jeder will heute mehr: Wir wünschen die simultane Verfügbarkeit verschiedener Dinge in einer Situation und genießen die Freiheit der Entscheidung.
Die mobilen Immobilien treffen heute auf ein anderes gesellschaftliches Verständnis. Wir sind heute eine reflexive Lebensführung gewöhnt. Die auf den Verbraucher abgestimmte Technik wird spielerisch erschlossen. Ihre szenische Qualität entspricht perfekt dem Lebensgefühl unserer Freizeitgesellschaft und ihrem hedonistischen Konsumverhalten.
Hinzu kommt die Verwischung der Grenzen zwischen Privat und Öffentlich und das Eindringen des Öffentlichen in das Private. Beides stellt den klassischen architektonischen Raum infrage und führt zur Auflösung der funktionalen Gebundenheit der Orte. Zusätzlich wird die Unschärfe der Räume und ihrer Nutzung durch eine unglaubliche Vielfalt an architektonischen Angeboten und Ausstattungsmöglichkeiten sowie die sich daraus ergebenden Ansprüche und widersprüchlichen Wünsche der Nutzer gefördert. Wir sind im Zeitalter der Ambivalenz. Es geht nicht um Kompensationsstrategien auf der Suche nach Auswegen, um nicht in einfache Bilder oder historische Gewissheiten zurückzufallen, sondern darum, die Qualitäten und Chancen dieser Freiheit für die Architektur zu begreifen und sie weiterzuentwickeln.
Die technische Entwicklung ist der Motor der Möglichkeiten. Siegfried Gideon hat anhand von mittelalterlichen Möbeln deren verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Mechanismen beschrieben. In der Architektur waren in den 1920er Jahren einfache, hauptsächlich durch den Klappmechanismus ermöglichte mechanische Systeme der Ausgangspunkt. Der Einsatz des Klappmechanismus wurde von der Moderne in einem Maßstabssprung auch auf Gebäudeteile übertragen. Ganze Wände wurden so disponibel, und Raumbestandteile konnten nach Belieben zusammengesetzt werden. Im Wesentlichen ging es um Raumeinsparung, durch die eine funktionale Doppelbelegung von Orten ermöglicht wurde.
In den 1960er Jahren vollzieht sich durch Gruppen wie Archigram oder Haus Rucker eine Entwicklung von den einfachen, mechanisch schon seit Jahrhunderten genutzten Systemen hin zu evolutiv computergestützten Vorgängen, die neue Materialentwicklungen nutzen und extreme Dehnungen und informative Bespielungen der Oberflächen ermöglichen.
Boten die 1960er Jahre einen visionären Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und waren eher erzählerisches Versprechen als Stand der Technik, verfügen wir heute über ein technisches Wissen, durch das der Computer selbstverständlicher Hintergrund unserer Lebenswirklichkeit ist. Der Einsatz beschränkt sich jedoch überwiegend auf intelligente Gebäudetechnologie zur Energieeinsparung und weniger auf die Veränderbarkeit des Raumes selbst.
Während in Wohnbauprojekten eher die einfachen mechanischen Systeme den klassischen Raumgedanken aufbrechen, finden die evolutiv computergestützten Systeme in kommerziellen oder öffentlichen Bauten ihren Einsatz. Beschränkung finden die Einsatzmöglichkeiten allein in den Kosten.
Form
Die Voraussetzung mobiler Immobilien ist, die Architektur nicht mehr allein von der Form her zu denken, sondern von ihrem Gebrauch und den potenziellen Situationen. Wir müssen uns im Entwurfsprozess auf die Vorstellung konzentrieren, was geschehen könnte, und uns nicht allein an den repräsentativen Fähigkeiten der Form begeistern.
Wir sind aufgefordert, uns dem formalen Zynismus, der sich in der Wiederholung und Selbstinszenierung architektonisch geläufiger Bilder gefällt, zu entziehen. Eine formale Strenge, die dem Einfältigsten über die Selbstbeschränkung signalisiert „Hier muss Architektur sein“, ermöglicht Erkennbarkeit, ist aber allenfalls die Negierung der Vielfalt und Freiheit sozialer und gesellschaftlicher Bedingungen und insofern unrealistisch. Die Eindimensionalität einer form- und stilorientierten Berufsgruppe mit ihrer permanenten Autoreferenz widerspricht in ihren architektonischen Ergebnissen der Realität einer postmodernen, pluralistischen Gesellschaft. Architektur ist eben nicht allein ein ästhetisches Objekt der Bewunderung oder symbolischer Repräsentation. Sie ist darüber hinaus Ausgangspunkt für das Leben. Es geht um eine strukturelle Ausdifferenzierung der Architektur analog zu den sich diversifizierenden Ansprüchen der Nutzer.
Das Formverständnis wandelt sich. Die klassische Form wird aufgelöst und die wahrnehmbaren Optionen, die dem Raum eingeschrieben sind, nehmen selbstbewusst ihren Platz und ihre Aufgabe ein – jedoch freier und offener. Im besten Fall entspricht der Umgang mit dem Raum eher einem Fließen zwischen den Optionen als einem gegenseitigen Abrufen. Architektur ist in diesem Selbstverständnis Prozess statt Form. Wir erleben eine Architektur, die formbefreit, transformativ ist und als Parcours und Sequenz wahrgenommen wird.
Die Grenzen des klassischen Raumes mit seinen „gefrorenen Formen und Nutzungen“ sind passé. Die neuen Räume haben Aufforderungscharakter und stellen ein vielschichtiges Angebot zur Verfügung, damit sich die Vielfalt, die Widersprüche und
die Mehrdeutigkeiten des sozialen Lebens in ihnen widerspiegeln können. Im Gegensatz zum Purismus der ästhetischen Einengung entsteht keine Architektur der finalen Form, sondern eine Architektur der Benutzer.
Kommunikation
Aufgrund der grenzenlosen Möglichkeiten der neuen Technologien des medialen Zeitalters ist Architektur ein Ort der Vernetzung und des Austauschs. Der klassische Ort der historischen und räumlichen Morphologien löst sich zugunsten eines Bedeutungsfeldes veränderbarer Relationen auf. Es ergibt sich ein neues paradoxes Bild von eingrenzender Individualisierung und unendlicher Relation.
„Jeder ist auf sich selbst zurückverwiesen. Und jeder weiß, dass dieses Selbst wenig ist. Das Selbst ist wenig, es ist aber nicht isoliert, es ist in einem Gefüge von Relationen gefangen, das noch nie so komplex und beweglich war“, so Jean François Lyotard.
Wieso sollte sich die Architektur dieser Realität und seinen Chancen entziehen? Architektur muss die Intelligenz besitzen, Relationen zur Umgebung, zum Nutzer und in den engeren und weiteren Raum hinein analog oder digital herzustellen. Sie muss fähig sein, einen Dialog einzuleiten, bei dem der Nutzer nicht nur Zuschauer formaler Perfektion ist, sondern Entscheidungsmöglichkeiten besitzt. Der Bewohner soll die Chance erhalten, nicht nur auf Starres zu reagieren, sondern in Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt zu agieren. Er soll mit einer Architektur konfrontiert werden, die Alternativen bietet und optional unterschiedliche Nutzungen ermöglicht. Flusser formuliert: „[…]künftige Gebäudeentwürfe werden Knotenpunkte für ein dialogisches Netz sein. Zum ersten Mal sind wir den Gewohnheiten nicht mehr unterworfen, sondern wir können sie entwerfen.“
Weshalb also Architektur im Umweg nicht nur als Ort, der mit Werkzeugen der Kommunikation ausgestattet ist, sondern ihn selbst als kommunikatives Medium begreifen, dessen Oberfläche nicht nur im Sinn informativer Aufladung bespielt wird, sondern dessen Struktur selber Qualitäten der Wandelbarkeit und Performance besitzt?
Dabei stellt die Flexibilisierung des Grundrisses nichts anderes dar als eine indirekte Kommunikationsform zwischen Architekt und Bewohner über den Verbindungsbruch der Fertigstellung.
Sowohl als auch
Da der Gebrauch vorstellbar, aber keinesfalls steuerbar ist, kann ein geradlinig diskursiver Entwurfsprozess wenig zielführend sein, wir müssen auch anders entwerfen. Der klassische architektonische Entwurfsprozess ist zu allererst ein
ereinfachungsmodell. Eine Situation wird von einer anderen unterschieden und schließlich die scheinbar bessere vorgezogen. Varianten dienen dazu, das Optimum zu ermitteln. Im Nachhinein entsteht ein nachvollziehbarer logischer Entwurfsverlauf mit einer Vielzahl von Entscheidungsknoten – „Entweder-oder“ lautet das Prinzip. Im Ergebnis entsteht für den Nutzer ein festgeschriebener, auf Dauer bindender architektonischer Zustand.
Wer in seinen Projekten die Komplexität der gesellschaftlichen Realität widerspiegeln möchte, muss sich vom Automatismus des Optimierungsmodells lösen. Die Architektur wird in Zukunft ein Einstieg in die Vielfalt der Möglichkeiten sein. Das setzt in Idealfall die Integration aller denkbaren Lösungsmöglichkeiten während des Entwerfens voraus.
Der eindimensionale Raum taugt in einer pluralistischen Gesellschaft als Lösung nur bedingt. Der Wunsch nach einer einzigen, möglichst klaren Lösung ist anachronistisch. Eine selbstbestimmte Gesellschaft verlangt die Verlagerung von Entwurfsentscheidungen in die Nutzungsphase. Entwerfen muss eher ein offenes Feld vielfältiger Möglichkeiten sein, in dem die funktionalen und sozialen Beziehungen jederzeit frei gestaltbar sind.
Die Strategie ist oft gleich: Zuerst werden die Dinge ihrem gewohnten Bedeutungszusammenhang und der fixierten Erwartung entrissen; danach werden ihnen Mehrdeutigkeit übertragen.
Wie kann man sich dies vorstellen? Ähnlich dem filmischen Konzept von „Lola rennt“ werden verschiedene denkbare Möglichkeiten im Projekt als gleichwertig betrachtet und wenn möglich verschmolzen. Ein tiefer, vielschichtiger, vielleicht auch undurchsichtiger Raum entsteht. Er gibt Chancen auf Entdeckungen; ihm sind Wünsche, Widersprüche und Optionen eingeschrieben. Er wird mehr bieten als das, was sich der Nutzer vorstellen kann oder er vom Architekten beim Auftrag erwartet. Er birgt formale und funktionale Geheimnisse, deren Andeutungen an der Oberfläche erscheinen und als Ausgangspunkt einer architektonischen Reise dienen. Der Entwurf spiegelt mögliche Szenen wider, setzt über die Einbeziehung mehrere Handlungsmöglichkeiten den Bewohner selbst in Bewegung und lässt ihn so als selbstbewusstes Steuerungselement im Raum aufgehen.
Distanzlosigkeit
Aneignung ist einer der Schlüsselbegriffe zum Verständnis der mobilen Immobilien. Aneignung ist grundsätzlich ein aktiver Prozess, besitzt jedoch statische und dynamische Aspekte. Aneignung ist im Verstehen und Einordnen des Raumes als ein geistiges Begehen des Ortes mittels der Sinne eher statisch und fordert im Personalisieren, im Verändern und Eingreifen die Dynamik des Bewohners heraus. Erst durch die Aneignung verleiht der Nutzer seiner gebauten Umgebung Bedeutung und schafft eine Bindungen zu ihr. Dabei geht es darum, den Raum „physisch, perzeptiv und emotional zu besetzen“. Der angeeignete Raum ist „stabiler Rahmen“ und zugleich Ausgangspunkt von Handlungsmöglichkeiten und Entdeckung. „Die Konstanz des architektonischen Raumes strukturiert das eigene Leben räumlich und zeitlich und regt gleichzeitig den Bewohner an, zu variieren und verändern.“ Aneignung vollzieht sich im Wechsel zwischen Assimilierung und Veränderung.
Das Gegenteil − die Enteignung − geschieht in lebloser anonymer oder dominanter Architektur, die aktive Auseinandersetzungen und Austauschverhalten nicht zulassen.
Im Blickpunkt des Projektes und Aneignungsprozesses steht zuerst der Nutzer. Die Logik und die einfach verständlichen Vorteile der oft ungewöhnlichen Funktionskombination mobiler Projekte erleichtert jedoch auch die Kommunikation mit den Beteiligten der Baustelle. Der strategische und konzeptionelle statt formale Ansatz macht die Projekte so robust, dass sie eine begrenzte „Überarbeitung“ und formale Veränderung durch die Beteiligten aushalten, da nicht die konsequent ausgeführte Form im Mittelpunkt steht, sondern die Tatsache unterschiedlicher Dispositionen des hergestellten Raumes. Die entspannte formgelöste Beziehung zwischen Architekt und Handwerker führt oft zu technisch besseren Lösungen. Quälendes Kompetenzgerangel und klassische Rollenschemata entfallen. Die Diskussion fokussiert sich nicht auf eine abbildgerechte,
millimetergenaue Ausführung, sondern auf die Ermöglichung der oft ungewöhnlichen, jedoch immer sinnfälligen Funktionsbeziehung. Der Humor, den die Projekte während der Ausführung auslösen, führt zu einer anderen Kommunikation. Die mobilen Projekte unseres Büros bedeuten für die Beteiligten auf der Baustelle – Bauherr, Architekt und Handwerker − vor allem Spaß.
Für mich jedoch war die kognitive sprachliche Aneignung des Raumes durch seine Bewohner die überraschende Erfahrung. Die ungewöhnliche Möglichkeit, über den Raum zu verfügen, löst bei „Fahrt ins Grüne“ nicht nur eine Handlung aus, sondern prägt auch die Sprache der Bewohner und Besucher − nicht nur in Bezug auf seine formale Repräsentation. Das Haus wird zum realen Partner, über den gesprochen wird, dessen Veränderungsmöglichkeiten sprachlich beschrieben und kommentiert werden. Distanzlosigkeit kennzeichnet die Auseinandersetzung. Das Szenische der Architektur und die Tatsache, dass diese nicht von sich selbst, sondern nur mit den Bewohnern in Gang zu setzen ist, schafft eine Selbstverständlichkeit und Vertrautheit im gegenseitigen Umgang. Das Gebäude wird als humorvolles oder bizarres Wesen wahrgenommen und beschrieben.
Die ungewöhnliche Tatsache, dass ein Haus beweglich ist, wird von seinen Bewohnern nicht allein als konsequent konzeptionell verstanden. Es bleibt nicht nur Objekt, sondern wird durch seine Bewegung zum lebendigen, gleichberechtigten Kommunikationspartner, dem vor allem Humor entgegengebracht wird. Zuerst empfand ich es als Beleidigung meines architektonisches Bewusstseins, dass hier Architektur in erster Linie nett und sympathisch wirkt und vor allem ihr Humor wahrgenommen wird. Immer mehr wurde mir aber klar, dass der Witz der Projekte und die Einbindung der Architektur in die Sprache der Bewohner die eigentliche Qualität ist und sich hierin eine Entspanntheit gegenüber der Architektur zeigt. Eine Architektur der Transformation und Option ohne Formdominanz ist eine, die direkt, unkompliziert und spielerisch, humorvoll poetisch und auch universell verständlich ist.
Ich habe in den über 10 Jahren des Bestehens von „Fahrt in Grüne“ nie jemanden getroffen, der die Nützlichkeit der Transformation nicht sofort erkannt und sich zudem nicht von der poetisch humorvollen Ebene des Projektes hat mitreißen lassen. Wer sein Haus hin und her schieben kann, verliert die devote Haltung vor der Ästhetik seines Eigenheims und erlebt eine Sinnlichkeit des Gebrauchs, die nicht nur nützlich ist, sondern vor allem Spaß macht. Architektur in Bewegung löst den Bewunderungszwang gegenüber einer perfektionistischen Architektur. Das Ungewohnte einer Architektur, die in ihrer Bewegung sich gleichsam selbst infrage stellt, löst Erstaunen und vor allem Lachen aus. Die für mich wesentliche Erfahrung ist nicht die eines praktischen Raumes vielfältiger Möglichkeiten, sondern das Lachen der Bauherren auf den Besprechungen, der Handwerker auf der Baustelle und der Besucher auf den Festen, wenn sie das Projekt in Bewegung erleben. War ich am Anfang eher irritiert, dass Freunde oder Bauherren den Humor des Projektes ansprachen, war mir später klar, dass hinter der sonst abwertenden Beschreibung die Qualität des Projektes gemeint war, mitten im Alltag der Nutzer angekommen zu sein.
Ich wünsche mir Gebäude, die keinen distanzierten Respekt, sondern einen familiäreren Ton auslösen. Nach dem Umweltpsychologen Carl-Friedrich Graumann ist Sprache das Medium und Organon (Werkzeug) der Interaktion und erschließt die Struktur und Bedeutung des Raumes für den Bewohner. Architekten sind daher aufgefordert, die sprachliche Auseinandersetzung der Bewohner mit ihren Gebäuden zu analysieren und daraus Konsequenzen zu ziehen. Die sprachliche Aneignung ist Ausdruck eines emotionalen Verhältnisses von Bewohnern zur ihrer Umwelt, in der sich die „Grundbedürfnisse konventionellen Erwartungen und rückgekoppelten Erfahrungen“ der Bewohner widerspiegeln.
Zugangsmöglichkeit
Kritik an optionalen Räumen ist immer gleich und zielt auf eine mangelnde Nutzung des Angebots. Nutzung der Optionen setzt natürlich das Verständnis voraus, wie ein mögliches Ergebnis erreicht werden kann. Eine Entscheidung darf nicht durch Unklarheit, wie der Veränderungsprozess abläuft, verhindert werden. Das setzt die Erkennbarkeit eindeutiger Angebote voraus.
Multiple Optionen müssen zudem Sinn machen. Es geht nicht um die Quantität des Angebots, in dem die einzelne Möglichkeit mit vielen weiteren konkurriert. Hieraus ergibt sich allein ein diffuses Bild von Beliebigkeit, in dem ein aufgeblasenes Angebot sinnentleert beschäftigt. Erst in einer wahrnehmbaren Differenz der Alternativen entfaltet sich die Option und hat der Handelnde auch tatsächlich Entscheidungsmöglichkeiten. Einem Plan sieht man an, wie ernsthaft die Option gemein ist, ob der Mensch und der menschliche Maßstab die Referenz ist. In den Zeichnungen von Ludwig Leo oder Renzo Piano ist immer der Mensch und ein mögliches Verhalten mit einbezogen. Die Entfaltung der Poesie des Gebrauchs ist letztendlich von der Einfachheit der Entscheidung und ihrer Kontrolle abhängig. Alternativen müssen klar differenziert werden und erkennbar sein. Veränderungsabläufe müssen unmittelbar ausgelöst werden können und der neue Raum sofort abrufbar sein.
Die Zugangsmöglichkeit setzt eine einfache Technik voraus: Es muss möglichst unkompliziert sein. Im Gegensatz zu den Vorstellungen der 1960er Jahre sehe ich wie Gustau Gili für die Zukunft eher eine Flexibilität durch Soft-Tec.
Stimulanz
Der Architekt entwirft Angebote, die eine jeweils vielfältige Disposition über den Raum ermöglichen. Deren Nutzung hängt von Wahrnehmung ab und dem Aufforderungscharakter, der unsere Motivation und unsere Bedürfnisse im Raum stimuliert.
Die Art und Weise, wie die Umwelt gestaltet wird, bestimmt den Grad der Stimulation, die die Personen auf alle Ebenen ihres Erlebens − von der Wahrnehmung bis zur Handlung − beeinflusst. Architektonische Gestaltung ist die Quelle von Affordanzen: So fordert ein Sessel zum Sitzen auf. Das Nutzerverhalten von Räumen ist über das Funktionsangebot definiert.
Der Raum muss Qualitäten bereitstellen, die die Eigenschaft besitzen, den Menschen über seine Sinnesorgane zu stimulieren. Dabei sind Unter- und Überstimulationen zu beachten.
Um die Attraktivität des Raumes sicherzustellen, sind Umwelteigenschaften „wie Komplexität, Neuheit und Inkongruenz für die Regulierung des Interesses“ erforderlich.
Stimulation ist nicht nur für die Wahrnehmung, sondern auch für die Entwicklung und Aufrechterhaltung eines normalen Verhaltens im Raum notwendig. Jedoch hängt eine aktive Exploration von dem Grad ab, bei dem bei der Person Unsicherheit und Konflikte auslöst werden. Die Ablesbarkeit, wie sich ein mobiler Raum entwickelt nimmt dem Nutzer seine Hemmung aktiv zu werden. Dabei sind Andeutungen möglicher Raumszenen hilfreicher, als eine bis in Detail gehende visuelle Vorwegnahme der Möglichkeiten. Der Antrieb mobile Immobilien zu nutzen besteht auch in der Neugier und der Aussicht Neues zu entdecken.
Räume müssen daher nicht nur klare Antworten bieten, sondern auch Fragen stellen und Erwartungshaltungen der Nutzer brechen, um Aufmerksamkeit und Motivation auch über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Der Nutzer braucht eine „gegliederte Reizung und einen variierten Input von Reizen“ Je größer und differenzierter der kognitive Raum, über den ein Mensch verfügt, umso größer ist die Möglichkeit, dass er sich auch in dem vom ihm repräsentierten Raum bewegt.
In allen Projekten versuchen wir, die übliche Verknüpfungsfixierung von Raum, Funktion und formaler Aussage bzw. Objekt und Gebrauch durch neue unerwartete Kombinationen von Teilen des Raumes aufzubrechen und in Bewegung zu setzen. Es geht darum, das Monotone, das Alltägliche, die funktionale Gebundenheit und die fixierten Erwartungen ans den Raum zu verhindern. Durch die Verankerung der Option fordert derselbe Raum zu neuer oder anderer Nutzung auf. Der Raum soll vom Benutzer immer wieder neu erfahren werden. Die Veränderung ist eine Infragestellung der grundsätzlichen Gewohnheiten. Im Handeln ist man aufgefordert, den Raum neu zu entdecken und zudem sich neu zu erklären. Mit der Nutzung ändern sich auch eingefahrene Konnotationen, Bedeutungen und sprachliches Verhalten. Es geht darum, das Aktionspotential der Nutzer
herauszufordern.
Vilem Flusser drückt dies folgendermaßen aus: „Die Wohnung als Netz von Gewohnheiten dient dem Auffangen von Abenteuern und dient als Sprungbett in Abenteuer.“
Im Zwischenraum
Für den Architekten geht es nicht darum, spröde, formale Fixierungen, sondern Vorstellungen von Situationen zu entwickeln, mögliche und erwartbare Handlungen zu kalkulieren und diese durch überraschende und stimulierende architektonische Elemente herauszufordern. Architekten sind aufgefordert, sich die Nutzung des Raumes in der Zeit vorzustellen und im Entwurf Szenen der Nutzung zu beschreiben und Abläufe zu schildern. Es geht letztendlich um das Verhalten im Raum und soziale Aktionen. Die Bedeutung des gestalteten Raumes ist nicht weniger wichtig, sie stellt sich nur indirekt, wenn er als Szenenhintergrund gesehen wird. Das Vokabular, ist das der Bühne und des Theaters. Dort ist das Entscheidende die Handlung. Architektur wird so als Katalysator von Interaktionen zwischen Architektur und Nutzer definiert. „Die Aufgabe besteht darin, Möglichkeiten freizusetzen, die die Umwelt in sich birgt, indem man durch Nutzbarmachung der Fähigkeiten der Bewohner eine Beziehung zwischen den Menschen und den Dingen aufbaut.“
Wenn Architektur die Kommunikation zwischen Hülle und Bewohner ermöglichen soll, verlagert sich zwangsläufig auch die Sichtweise des Entwerfens auf den Zwischenraum, den Aktionsraum des Nutzers. Die bedienende Hülle wird sekundär und erhält Bedeutung allein durch das Ermöglichen der Aktion. Architektur definiert insofern nicht nur den Raum, sondern stellt ein Angebot an Elementen zur Verfügung, die der Bewohner nutzen kann. Lerup vergleicht Gebäude mit Bühnen, die Requisiten zur Verfügung stellen, mit „denen die Bewohner ihr persönliches Schauspiel gestalten“. Da die Bewohner individuelle Erfahrungen und Vorstellungen mitbringen, sind sie nach Lerup keine repondierenden Organismen, sondern aktive Individuen, die das Gebäude erst in der Aneignung der eigentlichen architektonischen Bestimmung zuführen. Die Form und Intensität der Aneignung ändert sich im Laufe der Zeit der Nutzung und wird von den Nutzern rückgekoppelt. Die Beziehung zum architektonischen Raum ist ein offenes und dynamisches System vieler Faktoren.
Der Bewohner des Raumes ist nicht nur Nutzer und Erfüller der dem Raum vom Architekten übertragenen Verhaltensmuster. Er kann aus dem kalkulierten System des Architekten jederzeit ausbrechen und dieses sogar zweckentfremden.
Physischer Raum setzt daher kein unbedingtes Verhalten in Gang, er ist eher der Rahmen, in dem sich der Bewohner bewegt. Innerhalb des Angebotes wird er vor dem Hintergrund seiner individuellen Erfahrung eigene Umgangsformen entwickeln. Er ist Individuum mit eigenen Vorstellungen, eigener Biografie und auch einer Entwicklungsfähigkeit in der Beziehung zur Architektur. Der Nutzer verfügt durch das fixierte räumliche Gerüst über eine bestimmte Disposition, die er jedoch aufgrund seiner spezifischen persönlichen Erfahrungen jeweils unterschiedlich empfindet und nutzt. Die Beziehung zum Raum ist nicht nur Reaktion, sondern Interaktion zwischen Objekt und Subjekt. Architektur kommt daher eher einem Katalysator der Anregung und Wahrnehmungsunterstützung gleich. So führen unterschiedliche Biografien bei gleicher Umwelt zu anderen Wahrnehmungen und Verhaltensweisen. Umgekehrt erhält das Objekt in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Bedeutungen und Funktionen. Die Wechselwirkung ist also selbst bei konsequenten oder formal starren Räumen nicht fixiert, sondern Personen- und situationsabhängig. In der Konsequenz bedeutet dies eine Infragestellung der Allmacht der Planung.
Zyklische Zeit
Die Zeit als Teil architektonischer Vorstellung tauchtam Anfang der Moderne in Gideons „Raum Zeit und Architektur“ auf. Die baulichen Effekte der Transparenz werden mit Kunstwerken der Futuristen und Kubisten verglichen, und die Sinnlichkeit des Simultanen wird beschrieben als ein Standpunkt, von dem aus die Betrachtung verschiedener Standpunkte möglich ist. „ […]so wurde den drei Dimensionen, die den Raum der Renaissance umschrieben […] eine vierte angefügt: die Zeit.“
Walter Benjamin geht noch weiter, indem er nicht nur die Transparenz, sondern die Spiegelung betrachtet und von einer Durchdringungs- und Überdeckungstransparenz spricht, in der die Bedeutungen der Dinge oszillieren und ineinander übergehen. Die räumliche und zeitliche Simultanität und damit verbunden eine „Destabilisierung kognitiver Gewissheiten“
entsteht durch das „formale Wechselspiel zwischen Vordergrund und Hintergrund, Figur und Grund, Raum und Oberfläche“.
Erst die Einbeziehung der Zeit macht die komplexe Realität des Raumes von einem Standpunkt aus anschaulich. Der Raum erhält eine poetische Unschärfe, in der gedehnte Zeit und Augenblick, fixierter Standpunkt und Bewegung, Prozess und Situation, Gesamtheit und Ausschnitt im Simultanen aufgehen. Hinter der simultanen Wahrnehmung steht jedoch eher ein statischer Bildgedanke von Raum. Letztendlich ist die Methode das Einfrieren von Prozessen in einem angebotenen Bild. Zudem ist der Betrachter damit nur begrenzt einbezogen. Er hat keine Möglichkeiten auf der Handlungsebene, sondern findet einen rein visuell aufgeladenen Raum vor. Eine Aktion zwischen Objekt und Mensch ist nicht Ziel. Um den Zeitbegriff real zu verankern, muss aus einer rein visuellen Einbindung ein wirkliches Angebot werden und Bewegung in den Raum kommen.
Die Möglichkeiten müssen jedoch nicht nur erweitert, sondern, um die Entscheidungsfähigkeit des Nutzers nicht zu gefährden, vor allem wahrnehmbar strukturiert werden. Veränderungen im Raum dürfen kein neurotisches Nonstop einer zusammenhangslosen Beschleunigungsgesellschaft sein, die keinen Anfang und kein Ende mehr kennt. Option und Wandelbarkeit werden erst durch einen möglichen Rhythmus sinnvoll und selbstverständlich: Jahreszeiten, Temperaturwechsel, Tag-Nacht-Wechsel oder in Form mittelfristiger Zyklen für Ortswechsel, Atmosphären oder Funktionswandel. Dabei stellt Rhythmus für den Benutzer ein vertrautes Verhältnis zwischen Raum und Zeit her. Weil die Intervalle der Veränderung erklärbar bleiben, vermittelt er innerhalb der Wandelbarkeit das Gefühl von Konstanz. Der Rhythmus ist die Restrukturierung des räumlich entstrukturierten Raumes durch die Zeit. Die zyklische Zeit übernimmt den notwendigen Orientierungsmaßstab im befreiten, hierarchielosen Raum. Dieser Orientierungsmaßstab ist Ordnung und freier Fluss zugleich.
Architektur als Reise
Der optionale Raum ist kein festgeschriebener Ort. Für die Bewohner ist er das Medium der Veränderung und eine Art Begleiter auf der Reise durch die Zeit. Architektur, die sich bewegt, bedeutet eine Zustandsveränderung und Entfernung vom Gewohnten. Die Aktion, die der Nutzer auslöst, vermittelt zwischen Situationen. Das Gefühl, das bei dem Gebrauch der optionalen Architektur entsteht, ähnelt der Ambivalenz des Reisens, die zwischen dem Wunsch nach Erfüllung von fixierten Erwartungen − ausgelöst durch die Reiseführer − und Sehnsucht nach dem Unbekannten hin und her pendelt. Das Bekannte und Vertraute der realen Situation wird vom Unbekannten einer möglichen Situation hinterlegt. Risikobereitschaft ist nötig, um aus der Welt vertrauter Pauschalangebote auszubrechen. Erst durch Fortbewegung und Ortswechsel, ausgelöst durch Neugier, ist Freiheit erfahrbar und Horizonterweiterung möglich. Interessantes und Außergewöhnliches kann nur der mitbringen und mitteilen, der sich auf eine Reise begeben hat. „Nomaden reservieren, anders als die Sesshaften, nicht nur einige Wochen des Jahres für die Reise zum Glück − sie erheben sie zur Lebenskunst“.
Vilem Flussers Erkenntnis, dass „Nomaden erfahren und Sesshafte besitzen“ stellt klar, dass neue Erfahrungen nur im Schwebezustand der Improvisation und des Experiments eines Aufbruchs aus der Gewohnheit möglich sind. Ethnologen haben festgestellt, dass Nomaden keine ausgeprägte Religion und wenige Bräuche und Rituale besitzen. Das Reisen und die Erfahrung daraus ersetzen die Rituale. So bringt die Flucht aus dem Alltag der Architektur durch Bewegung einen direkten Erkenntnisgewinn und Nutzen ohne Umwege und kann auf eingefahrene Handlungsrituale verzichten.
Daneben führt das Reisen auch zu einem anderen konzentrierten Umgang mit den Dingen: Die Objekte werden kleiner und ihre Bedeutung konzentriert sich auf den Gebrauch statt die Ästhetik. Es geht um den realen Bezug zu den Dingen, die eher ermöglichen statt repräsentieren.
Ein weiterer poetischer Nebeneffekt der Bewegung und Veränderung in Zeit und Raum durch den Reisenden sind seine Spuren. Eine Architektur der Bewegung sollte sich der Poesie möglicher Spuren nicht verschließen. Als geplante oder über die Zeit entstehende Spuren können sie zu einem erkennbaren architektonischen Ausdruck des Raumes werden und die Möglichkeiten der Bewegungen und Optionen widerspiegeln. Es stellt eine Qualität und keinen Makel der Abnutzung dar, das Potential der Bewegung anhand von Spuren im Raum deuten und dechiffrieren zu können.
Poesie der Unsicherheit
Architektur ist der Versuch, Kontrolle über den Ort zu gewinnen. Architekten wollen den Raum beherrschen und haben gewöhnlich eine Abscheu vor ungelösten Fragen und Unwägbarkeiten. Das Unfertige stellt einen Makel dar, und Unsicherheiten lösen beim Bauherrn einen Vertrauensverlust aus.
Während der Planung wurde ich jedoch bei fast allen Bauherrenterminen mit sehr wechselhaften Vorstellungen und sich widersprechenden Ansprüchen konfrontiert. Die latente Ambivalenz auf Bauherrenseite wird mit der Unsicherheit des Architekten konfrontiert, der auf der Suche nach der bestmöglichen Lösung ist. Darüber hinaus ist nicht planbar, was mit einem Ort geschieht, da die Nutzer auf weitaus kreativer sein werden, als das, was Planung sich jemals vorstellen kann. Der unberechenbare Faktor ist der Nutzer. Es ist absurd, von ihm Beständigkeit zu erwarten. Gewissheit besteht allein darin, dass selbst die empirischste Planung durch die mögliche Nutzung und die Phantasie der Nutzer zweckentfremdet werden kann.
Der französische Philosoph Jean Baudrillard sieht jedoch im Kontrollverlust und der Unsicherheit eher einen Vorteil und spricht in diesem Zusammenhang von der Fantasie des Nutzers, der ein Gebäude zuweilen überraschend anders als geplant nutzt. Wir müssen als Planer erkennen, dass eine kreative Zweckentfremdung des Geplanten, wie sie auch die Situationisten in Abgrenzung zu banalen Hyperlogik der Moderne sahen, inspirierender ist als die Erfüllung der im Planungsprozess kalkulierten Verhaltensweisen durch den Nutzer. „Der Architekt kann nie hoffen das Objekt (d. h. das Gebäude selber) als Ereignis zu beherrschen […] diese (Ereignisse) entwickeln sich nach anderen Gesetzen“ und weiter… “unsere Welt wäre unerträglich, ohne diese inhärente Kraft des Missbrauchs. […] und ich glaube, auch hier liegt für die Architekten selbst etwas Verführerisches, sich vorzustellen, dass […] die Räume, die sie erfinden, […] Orte geheimer, zufälliger, unvorhersehbarer und sozusagen poetischer Verhaltensweisen sind, und nicht nur solcher, die offiziell und in statistischen Zahlen erfasst werden können.“
Die unabwendbare Tatsache des Kontrollverlustes über den Bau nach der Fertigstellung und Übergabe sollte daher zu anderen Strategien führen, als die Kontrollmechanismen in Allmachtsphantasien auszubauen bzw. die Handlungsmöglichkeiten durch gestalterische Vorgaben bewusst einzuengen. Wieso nicht einfach die Unsicherheit akzeptieren, in ihr eine geradezu poetische Kraft für das Projekt sehen, sie als Ausgangspunkt der Komplexität eines Projektes nehmen und bewusst Variablen einfügen? Ehrlicher und kontextueller wird das Projekt dadurch allemal.
Unsere Projekte schreiben daher selten eine klare Raum- oder Organisationsfolge vor, sondern bieten ein funktional wie formal offenes System. Für uns ist es das „Unfertige“, das dem Bewohner erst die Beteiligung ermöglicht, der durch seine Eingriffe die Gesamtheit herstellt. Wir wollen einen Raum, der über das Ergebnis des konstruierten Objekts hinausgeht, der das Potentielle mit einschließt und auch auf Bereiche außerhalb der eigenen Gestalt abzielt.
Neben unerwarteten Handlungen muss auch den unerwarteten Dingen Platz geboten werden. Hier geht es jedoch nicht nur um ein Kanalisieren eines gestalterischen Missstandes durch Architektur, sondern im Sinne von Charles Eames, der in der Architektur Form- und Wachstumsstrukturen unterscheidet, um eine gelöste Haltung und Sichtweise, die den eigentlichen Raum erst durch den Gebrauch und die Dinge, die diesen anfüllen, komplettiert sieht.
Das Ziel sollte jedoch nicht sein, ein neutrales Lager der reinen Infrastruktur zu entwickeln − sinnliche und physische Qualitäten bleiben ebenso notwendig. Die Dinge können, wenn sie als Ausdruck und Indikator der Intensität der Nutzung in die Gestaltung einbezogen werden, ungemein hilfreich sein, um einen freieren Begriff von Schönheit zu ermöglichen.
Der optionale Raum setzt daher nicht zwangsläufig die reine Struktur und neutrale Zone voraus − zurück zu den 1960ern will keiner. Wenn überhaupt ist das Vorbild eher Cederic Price als Constant und Archigram. Price schafft in seinen flexiblen Räumen den menschlichen Bezug am ehesten über seine Maßstäblichkeit und konzeptionelle Sensibilität, die sich allen plakativen oder formalen Bildern entzieht und ehrliche Angebote schafft.
Zur Akzeptanz brauchen optionale Räume jedoch vor allem einen architektonischen Ausdruck. Neutrale Strukturen führen durch die Auflösung wahrnehmbarer Differenzen zu Gleichförmigkeit und – laut Richard Sennett – damit nachvollziehbarerweise zur Monotonie unserer Städte, in der zwar Flexibilität durch Austauschbarkeit ermöglicht wird, jedoch auf Kosten ihrer dadurch emotionslos gewordenen Bewohner. Raum braucht architektonische Präsenz; diese muss jedoch nicht zwangsläufig fixiert bleiben. Notwendig sind Räume, die Atmosphären schaffen, in denen die Sensationen des Objektes erlebbar und synästhetisches Erleben durch Wandelbarkeit angeregt wird.
Es geht immer auch um die Frage, was Räume erzeugen, denn „Architektur besitzt die Rolle, die [Walter] Benjamin dem Kino zugesprochen hat: der Vertiefung der Wahrnehmung − im Falle mobiler Immobilien einer komplexeren Wahrnehmung von sich ändernden Erscheinungen.
Mögliche Wirklichkeiten
„Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch einen Möglichkeitssinn geben. […] Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird das bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann.
Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müsste geschehen; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun es könnte wahrscheinlich auch anders sein.“
Entwerfen geschieht im Konjunktiv und ist ein Versprechen in die Zukunft hinein. Die Verbindung von Gegenwart und Zukunft, die im Entwurfsprozess stattfindet, ist die eigentliche Poesie. Der Sinn für die „mögliche Wirklichkeit“ oder „wirkliche Möglichkeiten“ setzt jedoch für beide − Architekt und Nutzer − Phantasie voraus.
Ebenso ist es mit dem fertig gestellten Raum. Ein Raum, der sich verwandelt, ist nicht sofort erklärbar. Er verliert seinen festlegenden Charakter, wird interpretierbar und erhält eine bildliche Tiefenwirkung. Für den Bewohner wird wahrgenommener, gegenwärtiger und möglicher zukünftiger Raum in der Vorstellung synthetisiert und in einen Schwebezustand visueller Mehrdeutigkeit überführt, der über das Reale hinausgeht. Sichtbarer und potentieller Raum verschmelzen, oder wie Jean Baudrillard sagt: „Ein gelungener Raum ist ein Raum, der jenseits der eigenen Realität existiert.“
Der Raum wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln „in einer Sphäre der Unsicherheit zwischen Bewusstem und Unbewusstem “ ausgelotet. Die Überlagerung der möglichen Raumszenen hat eine Freiheit der eigenen Sichtweise zur Folge, in der mehr Raum gesehen wird, als im Augenblick real vorhanden ist.
Erst durch das fiktive Element und die Verlängerung des realen in den vorgestellten Raum und die Vermischung von Gegenwart und ihrem Potential wird die Wirklichkeit des Raumes komplexer und sinnlicher. Der Konjunktiv ist ein reales verfügbares Versprechen und latenter Antrieb für den Nutzer.
Psychologisch bedeutet der Schwebezustand für den Benutzer eine Befreiung. Ein offener Raum beinhaltet das Potential vielfältiger Aktionen. Entscheidend ist nicht allein die ständige, tatsächliche Nutzung der Optionen, sondern die Gelassenheit, die entsteht, wenn man potentielle Variationsmöglichkeiten besitzt. Selbst das Belassen der „wirklichen Möglichkeiten“ in der Vorstellung wirkt befreiend.
Nachwort
„Fahrt ins Grüne“ wurde 1997 und „Zimmer mit Aussicht“ 2008 fertig gestellt. In den mehr als 10 Jahren zwischen den beiden Projekten entstand in unserem Büro eine Vielzahl von theoretischen Arbeiten und realisierten mobilen Projekten. Meine Hochschularbeit und die Auseinandersetzung mit vielen studentischen Arbeiten hat die praktische Arbeit angeregt und kontinuierlich motiviert.
Das vorliegende Buch ist Ergebnis einer vom Bundesministerium für Forschung und Bildung unterstützten Forschungsarbeit zum Thema Nutzungsverdichtung am Lehrgebiet Architekturtheorie der FH Mainz im WS 07/08. Sie greift auf einige Gedanken der in den letzten Jahren entstandenen theoretischen Arbeiten und Vorträge zurück, ordnet, ergänzt und erweitert diese. Das Buch will den Diskurs und das leidenschaftliche Streiten für eine direkt zugängliche Architektur in Gang halten und ist in der Überzeugung geschrieben, dass es unterschiedliche Lösungen gibt, die nicht zwangsläufig mobil sein müssen. Die vertretenen Inhalte und dargestellten Projekte sind Beispiele und nicht gegen andere Auffassungen geschrieben, die sich ebenso für eine offene, humorvolle und gebrauchsorientierte Architektur engagieren.